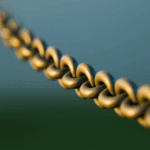Politiker halten oft die wirtschaftspolitischen Regeln, die sie miteinander vereinbaren, ungestraft nicht ein. Das gilt insbesondere für die Staatsverschuldung. Das Problem ist jedoch nicht neu. Vom bekannten österreichischen Nationalökonomen Alois Schumpeter stammt der Ausspruch: „Eher legt sich ein Mops einen Vorrat an Würstchen an, bevor ein Politiker spart!“ Dieser sarkastische Vergleich bestätigt sich im starken Anwachsen der Verschuldung der öffentlichen Hände in den meisten Industrieländern.
Pro Sekunde steigen die Schulden in Deutschland um 3.393 €; pro Kopf der Bevölkerung belaufen sich die Staatsschulden auf 29.766 €. Rechnet man die Staatsverschuldung um auf eine tägliche Kreditaufnahme seit der Geburt Christi (ohne Zins und Zinseszins), kommt man auf eine tägliche Neuverschuldung von 3,9 Mio. Euro – oder pro Stunde 141.281 € bzw. pro Sekunde i.H.v. 39 €. Unsere Regierungen haben dies aber in den letzten 60 Jahren geschafft.
Im Jahre 1969 hatte die Bundesrepublik das letzte Mal ein wirklich ausgeglichenes Budget. Die gesamte Staatsverschuldung der öffentlichen Hand lag damals bei 125,9 Mrd. DM (ca. 63 Mrd. €). Der Anteil des Bundes lag bei 49,7 Mrd. DM (knapp 25 Mrd. €). Ende 2023 waren die öffentlichen Haushalte in Deutschland mit knapp 2.500 Mrd. € verschuldet – wobei dem Bund ca. 70%, den Ländern ca. 24% und den Gemeinden ca. 6% zuzurechnen sind.
Diese Zahlen geben aber nur einen Ausschnitt der staatlichen Verschuldung wieder. Neben der offiziell ausgewiesenen Staatsverschuldung muss auch noch die versteckte Staatsschuld berücksichtigt werden, nämlich die Ansprüche aus den Renten, Pflege- und Gesundheitsversicherungen oder den Beamtenpensionen. Sind diese hohen Staatsverschuldungen gerechtfertigt oder in irgendeiner Weise vielleicht doch unmoralisch?
Bei Einführung des Euros wurde auf deutschen Druck hin (dank der Bemühungen des damaligen Finanzministers Waigel) ein Stabilitätspakt in der Europäischen Union vereinbart, der zu einer Eindämmung der Staatsverschuldung beitragen sollte. Da zum Zeitpunkt des Abschlusses der Maastrichter Verträge die durchschnittliche Staatsverschuldung in den Mitgliedsländern der EU bei 60 % lag und man von einer jährlichen Wachstums- rate von 5 % ausging, vereinbarte man ein Limit der Neuverschuldung von 3 %. Dadurch sollte die Verschuldung konstant bleiben. Wichtige europäische Staaten wie Frankreich, Deutschland und Italien waren nicht in der Lage, diese großzügige Begrenzung von 3 % der Neuverschuldung bezogen auf das BNE einzuhalten. Sanktionen müssen die beschuldigten Staaten zum Teil über sich selbst festlegen. Sünder müssen über Sünder richten! Es ist unwahrscheinlich, dass Sanktionsmaßnahmen auf europäischer Ebene gegen Übertretungen dieser Vereinbarung durchgesetzt werden.
Historische Sichtweisen zur Staatsverschuldung
Das Problem öffentlicher Schulden ist alt. Schon Cicero bemerkte „das Budget sollte ausgeglichen sein, die öffentlichen Schulden sollten reduziert werden und die Bürger sollten mehr arbeiten als sich auf die Gaben der Regierung zu verlassen!“ Die Merkantilisten hingegen standen der Verschuldung des Staates positiv gegenüber.
Der deutsche Staatsrechtler und Finanzwissenschaftler Lorenz von Stein (1815-1890) schreibt in seinem bekannten Lehrbuch der Finanzwissenschaft (1860): „Ein Staat ohne Staatsschuld tut entweder zu wenig für seine Zukunft oder er fordert zu viel von seiner Gegenwart“. Damals hat sich der Staat verschuldet, um die Infrastruktur auszubauen, sonst hätte er über Gebühr die gegenwärtige Generation belasten müssen. Staatsschuld scheint notwendig zu sein, um die Ressourcen eines Landes ausschöpfen zu können.1
Ganz anders dagegen die Sicht der klassischen Ökonomen, die staatliche Ausgaben für unproduktiv halten, da sie nicht zu einer Erhöhung des Wohlstandes der Bevölkerung beitragen, sondern einen Akt der Zerstörung darstellen.
Adam Smith wirft dem Staat eine Vergeudung von Kapital vor, weil er mit den Mitteln, die er den Bürgern entzieht, nur unproduktive Arbeit unterstützt. Einer der schärfsten Kritiker der Staatsverschuldung war David Ricardo. Nach ihm ist die öffentliche Verschuldung die schrecklichste Geißel, die je zur Plage der Nationen erfunden wurde. Auch er unterstellt einen unproduktiven Staat. Liberale Vorstellungen verlangen daher einen Minimalstaat, der ein ausgeglichenes Staatsbudget vorlegt.
Zu Beginn des letzten Jahrhunderts waren die staatlichen Aufgaben eingeschränkt. Für die wirtschaftliche Entwicklung wurde es als vorteilhaft angesehen, wenn der Staat nur die Rahmenbedingungen festlegen und so wenig wie möglich das wirtschaftliche Geschehen beeinflussen würde. In der großen Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre hat der Staat dann vermehrt Aufgaben übernommen. Insbesondere durch den englischen Ökonomen John Maynard Keynes wurde dem Staat eine Stabilisierungsaufgabe zugeordnet. Seit Mitte des letzten Jahrhunderts hat der Staat ständig weitere Kompetenzen an sich gezogen. Sobald in der Gesellschaft ein Problem auftauchte, wurde der Staat für die Lösung verantwortlich gemacht. Dadurch wurden die Bürger entmündigt; sie waren in immer geringerem Maße für ihr Lebensschicksal selbst verantwortlich.
Unter Verletzung des Prinzips der Subsidiarität hat der Staat die ökonomische Absicherung der Bürger übernommen, so dass der Wille zur Eigenverantwortung mehr und mehr nachließ. Wie ist dies ökonomisch und ethisch zu beurteilen.
Staatsverschuldung aus ökonomischer Sicht
Bei der Staatsverschuldung muss unterschieden werden, ob der Staat seine Ausgaben für konsumtive oder investive Mittel einsetzt. In dem genannten Anfangszitat von Lorenz von Stein wird ein produktiver Staat, wie bei den Merkantilisten üblich, unterstellt. Demzufolge kann der Staat sich für die Entwicklung der Infrastruktur und des Bildungswesens verschulden. Spätere Generationen sind Nutznießer dieser durchgeführten Investitionen und müssen sich durch ihrer Rückzahlung an den Kosten der getätigten Investitionen beteiligen. Demnach hat ein Staat, der sich nicht verschuldete, nichts für die wirtschaftliche Entwicklung getan. Sollte er dennoch die Infrastruktur usw. verbessert und sich nicht verschuldet haben, dann hat die gegenwärtige Bevölkerung die ganze Investitionslast zu tragen. Schon Adam Smith unterschied zwischen den produktiven und den nicht-produktiven Staatsausgaben. Soweit ein Staat Investitionen durchführt, ist, wie bei Firmen, eine Verschuldung also gerechtfertigt.
Die keynesianische Wirtschaftstheorie hat herausgearbeitet, dass der ausgeglichene Staatshaushalt, den die Neoliberalen und Monetaristen fordern, nur über dem Konjunkturzyklus erreicht werden muss. Ein Staat sollte das Potential zur kurzfristigen Verschuldung haben, wenn er im Fall einer Rezession Anreize für die wirtschaftliche Entwicklung gibt. Die dann aufgenommenen Schulden sollten dann aber in der Boom-Phase wieder zurückgezahlt werden.
Das Entscheidende ist also nicht die Staatsverschuldung als solche, sondern die Ver(sch)wendung der Staatsausgaben. Wenn der Staat durch seine Investitionen zu einer Erhöhung des volkswirtschaftlichen Angebots derart beiträgt, dass Angebot und Nachfrage in gleicher Weise ausgedehnt werden, dann ist die Staatsverschuldung weder inflationär noch eine spätere Belastung für die Enkel.
Das Problem der europäischen Staaten liegt nur deshalb in der hohen Staatsverschuldung, weil die Ausgaben für soziale Zwecke getätigt wurden und der Anteil der Investitionen an den Staats- ausgaben kontinuierlich zurückging. Es fragt sich nun, wie es dazu gekommen ist, dass der Staat so unökonomisch entschied.
Wie erklärt sich die hohe Staatsverschuldung?
Die Staatsverschuldung ist nicht nur das Ergebnis einer niedrigen Politikertugend. Zwischen den Anreizen (Verantwortungsethik) und den Motiven (Individualethik) muss unterschieden werden. Auch Politiker sind Sünder und verhalten sich nicht immer gesellschaftlich optimal. Eine Hauptursache der hohen Staatsverschuldung liegt in verfassungsmäßigen Regeln unserer Gesellschaft, wie ich im Folgenden zeigen werde.
Die neue politische Ökonomik (NPÖ) betont im Gegensatz zur älteren Wirtschaftstheorie, dass sich Politiker wie normale Bürger nutzenmaximierend verhalten. Max Weber unterstellte noch, dass Politiker das Gemeinwohl anstreben; die Makroökonomik übernimmt diesen Gedanken und übergibt dem Politiker eine große fiskalische und wirtschaftspolitische Verantwortung, weil unterstellt wird, dass die Politiker zum Besten der Bevölkerung entscheiden.
Hiergegen wendet sich die NPÖ. Sie unterstellt, dass Politiker hauptsächlich ihre Wiederwahl anstreben. So wie der Unternehmer seinen Umsatz maximiert, so streben die Politiker eine Stimmenmaximierung an. Um Stimmen zu bekommen, müssen sie bestimmten gesellschaftlichen Gruppen „Bonbons zu- stecken“. Sie müssen sich hüten, die Wähler zu vergraulen. So erklärt sich die große Reformunfähigkeit der westeuropäischen Länder, da es selten Staatsmänner gibt, die ihre Visionen den Wählern vermitteln können. Politiker richten sich nach den sensiblen Wählergruppen und müssen staatliche Dienstleistungen anbieten. Steuererhöhungen sind unbeliebt. Daher wählt der Politiker den Verschiebebahnhof und zieht die Staatsverschuldung vor.
Um weiter ausufernde Staatsverschuldung zu vermeiden, müssten Sanktionen gegenüber der politischen Klasse in die Verfassung aufgenommen werden. Das Problem der Wirtschaftspolitik besteht darin, dass die politische Klasse als Gesamtheit von den Bürgern nicht sanktioniert werden kann. Es gibt weder einen Volksentscheid noch ein größeres Mitspracherecht des Bürgers.
Der Politiker gewinnt keine Wahlen, wenn er Fehler eingesteht. Man sucht die Ursachen in der schlechten Konjunktur, im Ausland, usw. Die wissenschaftliche Politikberatung, auf die der ehemalige Bundeskanzler und Wirtschaftsminister Ludwig Erhard Wert legte, hat heute kaum Einfluss. Politiker entscheiden meist gegen den Rat der Wissenschaft. Wissensmangel in der politischen Klasse und in der Bevölkerung führen dazu, dass die Ursachen für die hohe Staatsverschuldung und deren langfristige Konsequenzen nicht beachtet werden. So haben Wissenschaftler schon seit Jahrzehnten auf das drohende Problem in der Rentenversicherung hingewiesen. Seit Jahrzehnten werden auf Schwachpunkte des Gesundheitswesens die Finger gelegt und die Politik wagt es nicht Reformen durchzuführen, die län- ger als ein Jahr halten.
Ein weiteres Problem liegt im Einfluss der Interessensverbände. Politiker können im Auftrag der Interessensverbände tätig sein. Sie können neben ihrem Abgeordnetenamt oder ihrem Regierungsamt auch noch für Interessengruppen wirken. Interessen- gruppen unterstützen die Parteien und erhalten dadurch Einfluss. Sie können über die Medien Politiker unterstützen oder gefährden. Von daher haben die Interessensverbände einen sehr starken Einfluss auf wirtschaftspolitische Entscheidungen.
Ein Truthahn lebt 155 Tage wie in einem Schlaraffenland – und dann wird ihm der Kopf abgehackt. Ähnlich sorglos lebten auch einige europäische Länder. Mit billigem Geld lassen sich jedoch keine Krise erfolgreich bekämpfen.
Nachhaltigkeit als ethisches Postulat
Die Bibel ist gegenüber einer Verschuldung zurückhaltend. Sie warnt vor leichtfertiger Überschuldung (Sprüche 22,7; Ps. 37,21). Jedoch: Wer in Not geriet und einen Kredit aufnehmen musste (selbstschuldnerische Bürgschaft) der unterlag dem alle sieben Jahre stattfindenden Erlassjahr, in dem Schulden vergeben werden mussten. Die Bibel mag anscheinend keine langfristige Verschuldung, um zukünftige Generationen nicht zu belasten, d.h. die Fortsetzung von Sippe und Familie nicht zu gefährden.
Staatliche Schuldenaufnahme bedeutet nämlich nicht nur ein Verschieben der Gegenleistung, sondern auch ihr Abwälzen. Man spricht in dem Zusammenhang von einer „Lastenverschiebung“. Im Grunde genommen wird zwangsweise zu Lasten späterer Generationen eine Umverteilung vorgenommen, die naturgemäß an der Entscheidung nicht mitwirken konnten. Im BGB ist im Privatrecht ein Vertrag zu Lasten Dritter verboten. Nur im politischen Bereich können Politiker spätere Generationen belasten
Privat hört man oft Eltern sagen: „Unsere Kinder sollten es besser haben!“ Es besteht kein Grund, warum diese Maxime nicht auch für die Wirtschaftspolitik ein Leitbild sein sollte. Die Politik verhält sich jedoch umgekehrt. Unsere wirtschaftspolitischen Fehler mögen unsere Kinder auslöffeln, Hauptsache wir haben die nächste Wahl gewonnen! 2
Bill Clinton hatte in den USA eine Reduzierung der Staatsverschuldung erreicht. Staatlicher Schuldenabbau ist möglich, wenn die politischen Eliten es wollen.
Die deutsche Wirtschaftspolitik ist von Ratlosigkeit geprägt. Der Staat wird durch hohe Verschuldung immer handlungsunfähiger und ist heute kaum noch in der Lage, die erreichte Infrastruktur den Kindern zu vererben.
Da die Tugend der Politiker nicht ausreicht (Motivationsethik), um Änderungen anzubringen, wäre es notwendig, die Rahmenbedingungen zu verändern. Die Bürger müssten bei der Verschuldung ein Mitspracherecht haben. Verfassungsmäßig dürfte es über dem Konjunkturzyklus keine Staatsverschuldung geben, die über die Höhe der Nettoinvestitionen hinausgeht.
Aus motivationsethischen Gründen wäre es notwendig, verantwortungsethisch zu handeln und die Rahmenbedingungen so zu verbessern, dass die Politiker nicht zu Lasten zukünftiger Generationen unser Volk noch weiter wirtschaftspolitisch schlecht regieren. Es fehlen einerseits kompetente Staatsmänner wie Ludwig Erhard, die um einen gute Wirtschaftspolitik rangen, andererseits fehlen Regelmechanismen, die den Politikern einen Anreiz geben, nachhaltige Entscheidungen zu treffen. Wir benötigen in Deutschland eine ethische und religiöse Neubesinnung.
Der Reiche herrscht über die Armen; und wer borgt, ist des Gläubigers Knecht. Sprüche 22,7
Der Frevler muss borgen und bezahlt nicht, aber der Gerechte ist barmherzig und gibt. Ps. 37,21
1: Vgl: hierzu: W. Lachmann: Fiskalpolitik, Berlin et al 1987, Kap. 6: Fiskalpolitik kontrovers, S. 65ff.
2: So soll Bundeskanzler Kohl mehrmals gesagt haben: „Ich will nicht den Ludwig-Erhard-Preis gewinnen, sondern die nächsten Wahlen!“